Amsterdam bekennt Mitschuld am Holocaust
| von Redaktion

AMSTERDAM · Offizielle Entschuldigung für historisches Unrecht: Bürgermeisterin Femke Halsema hat im Namen der Stadt Amsterdam öffentlich um Entschuldigung für die Mitwirkung der Stadtverwaltung an der Verfolgung und Deportation jüdischer Bürger während des Zweiten Weltkriegs gebeten. Die Erklärung erfolgte am Donnerstagabend bei der Jom-Hasjoa-Gedenkfeier in der Hollandsche Schouwburg – einem zentralen Ort jüdischen Leidens. Die Stadt gesteht damit ein moralisches Versagen in ihrer eigenen Verwaltungsgeschichte ein. Zugleich kündigte Halsema eine Investition in Höhe von 25 Millionen Euro zur Förderung jüdischen Lebens in der Stadt an – ein symbolischer wie materieller Schritt zur Wiedergutmachung.
Während der Gedenkveranstaltung anlässlich des Jom Hasjoa, bei der der Holocaust und seine Opfer im Mittelpunkt stehen, sprach Bürgermeisterin Femke Halsema eindringliche Worte in einem symbolträchtigen Rahmen. In ihrer Rede erinnerte sie an das große Unrecht, das jüdischen Amsterdamerinnen und Amsterdamer im Zweiten Weltkrieg widerfuhr – nicht nur durch die deutschen Besatzer, sondern auch durch das aktive Mitwirken der städtischen Verwaltung. Von der frühzeitigen Registrierung jüdischer Einwohner über die Bereitstellung von Transportmitteln bis hin zur Beteiligung der Stadtpolizei an Razzien: Die niederländische Hauptstadt war tief in die Mechanismen der Verfolgung eingebunden. Dass rund 60.000 der knapp 80.000 jüdischen Einwohner Amsterdams ermordet wurden, ist Ausdruck eines kollektiven Versagens. Besonders drastisch beschrieb Halsema das Schicksal der jungen Chaja Borzykovski, die nach ihrer Festnahme zusammen mit ihrer Familie mit einer städtischen Straßenbahn zum Muiderpoort-Bahnhof gebracht und später im Vernichtungslager Sobibor ermordet wurde – ein Einzelschicksal, das für viele steht. Auch nach der Befreiung setzte sich die Hartherzigkeit der Stadtverwaltung fort, etwa durch das Einfordern von Nachzahlungen und die Rückgabe zerstörter oder enteigneter Häuser ohne Rücksicht auf die Überlebenden. Mit der nun erfolgten Entschuldigung und der angekündigten Investition will die Stadt ein sichtbares Zeichen setzen, um jüdisches Leben in Amsterdam dauerhaft zu fördern und das historische Unrecht nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Historisches Versagen – institutionell und moralisch
Die historische Verantwortung der Gemeinde Amsterdam während der NS-Besatzung war lange ein gesellschaftliches Tabuthema. Nun, 80 Jahre nach Kriegsende, hat Bürgermeisterin Halsema im Namen der Stadt eine überfällige Aufarbeitung eingeleitet. Ihre Worte waren deutlich: Die städtische Verwaltung habe versagt – nicht aus Ohnmacht, sondern aus bereitwilliger Kooperation mit den Besatzern. Noch vor der offiziellen Machtübernahme durch NSB-treue Verwaltungsbeamte halfen kommunale Stellen dabei, die Infrastruktur der Judenverfolgung aufzubauen. So wurden jüdische Bürger systematisch registriert, ihre Wohnorte kartografiert, und sie wurden stigmatisiert, isoliert und schließlich deportiert – mit Hilfe der kommunalen Polizei und städtischen Straßenbahnen. Die Hollandsche Schouwburg, in der Halsema ihre Rede hielt, war selbst ein zentraler Sammelpunkt vor der Deportation – auch dies ein mahnendes Symbol für die städtische Beteiligung am Unrecht.
Versäumnisse nach der Befreiung
Doch das Versagen endete nicht mit der Kapitulation der Wehrmacht. Die Rückkehr der wenigen Überlebenden wurde von Kälte und bürokratischer Härte begleitet. Häuser waren zerstört oder fremdgenutzt – oft legalisiert durch notarielle Eintragungen. Wer seine Wohnung zurückerhielt, wurde mit Zahlungsaufforderungen und Bußgeldern konfrontiert. Diese Behandlung offenbart eine nachhaltige Entmenschlichung und mangelnde Bereitschaft zur Verantwortung in der Nachkriegszeit. Halsema nennt dies in ihrer Rede einen "zweiten Verrat" – diesmal nicht durch äußere Feinde, sondern durch die eigene Stadtgesellschaft.
Investition in jüdisches Leben als Zeichen der Reue
Neben der moralischen Anerkennung vergangener Fehler kündigte Halsema auch konkrete Maßnahmen an: 25 Millionen Euro sollen in die Zukunft jüdischen Lebens in Amsterdam fließen. Eine von der ehemaligen Ministerin Jet Bussemaker geleitete Kommission wird über die Verwendung der Mittel wachen, gemeinsam mit jüdischen Organisationen. Die Gelder sind ausdrücklich nicht für Sicherheitsmaßnahmen oder Gedenkfeiern gedacht, sondern für kulturelle, gesellschaftliche und bildungspolitische Projekte, die das jüdische Leben nachhaltig stärken sollen.
Stolperschwellen als Erinnerung im Alltag
Zusätzlich kündigte die Stadt das Aufstellen sogenannter „Stolperschwellen“ (struikeldrempels) an – großformatige Gedenkplatten, die an deportierte Bürger erinnern. An zentralen Orten wie dem Muiderpoortbahnhof und dem Jonas Daniel Meijerplein – dem Schauplatz der ersten großen Razzien – sollen sie täglich an das Unrecht erinnern. Auch dies ist Teil der aktiven Erinnerungskultur, die nicht nur auf Museen oder Denkmäler beschränkt bleiben soll.
Ein symbolträchtiger Ort, ein notwendiges Zeichen
Dass Halsema ihre Rede ausgerechnet in der Hollandsche Schouwburg hielt, ist kein Zufall. Hier wurden Tausende jüdische Bürger vor ihrer Deportation interniert. Die Gedenkstätte ist heute eines der bedeutendsten Mahnmale der Shoah in den Niederlanden. Dass ausgerechnet dort die Stadt erstmals offiziell Verantwortung übernimmt, verleiht der Entschuldigung besonderes Gewicht. Das Motto Amsterdams – „Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig“ – stehe in krassem Widerspruch zu den historischen Tatsachen, wie Halsema deutlich machte.
Ein verspätetes, aber wichtiges Zeichen
Auch wenn die Entschuldigung spät kommt, so ist sie umso bedeutender. Das Centraal Joods Overleg erklärte, die Geste gebe der jüdischen Gemeinschaft in Amsterdam ein Stück ihrer Identität, ihrer Würde und ihrer Stimme zurück. Sie sei nicht nur ein symbolischer Akt, sondern ein ernstgemeinter Beitrag zur Wiederherstellung des Vertrauens. Die Shoah darf nicht auf die fünf Jahre der Verfolgung reduziert werden – sie ist eingebettet in eine viel längere Geschichte jüdischen Lebens in der Stadt. Genau diese Geschichte will die Stadt nun stärken, bewahren und fördern – als Teil der Amsterdamer Identität.
In eigener Sache

Bitte unterstütze uns
Unsere Aktivitäten und diese Webseite bieten wir kostenlos an. Wir tun dies gerne und freiwillig. Um unseren Service weiterhin anbieten zu können, schalten wir Werbung und nutzen Affiliate-Links. Deine Unterstützung, sei es durch Mitarbeit oder eine Spende in Höhe einer Tasse Kaffee über PayPal, ist uns sehr willkommen und hilft uns enorm.
Vielen Dank dafür!
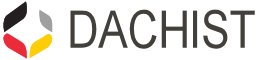





















Kommentare
Einen Kommentar schreiben